Gutes Essen für alle. Wer wollte dagegen sein? Morgen demonstriert in Berlin ein breites gesellschaftliches Bündnis für eine nachhaltige Landwirtschaft, für gesunde, bezahlbare Nahrungsmittel, für die so dringend notwendige sozial-ökologische Transformation, die alle Lebensbereiche erfassen muss.
In diesem Jahr gehört Diakonie Deutschland erstmals zu den offiziellen Unterstützer:innen der Großdemonstration „Wir haben es satt“, die seit 2001 den Auftakt der weltgrößten Agrarmesse „Grüne Woche“ kritisch begleitet. Auch so geht „Diakonie mit anderen“.
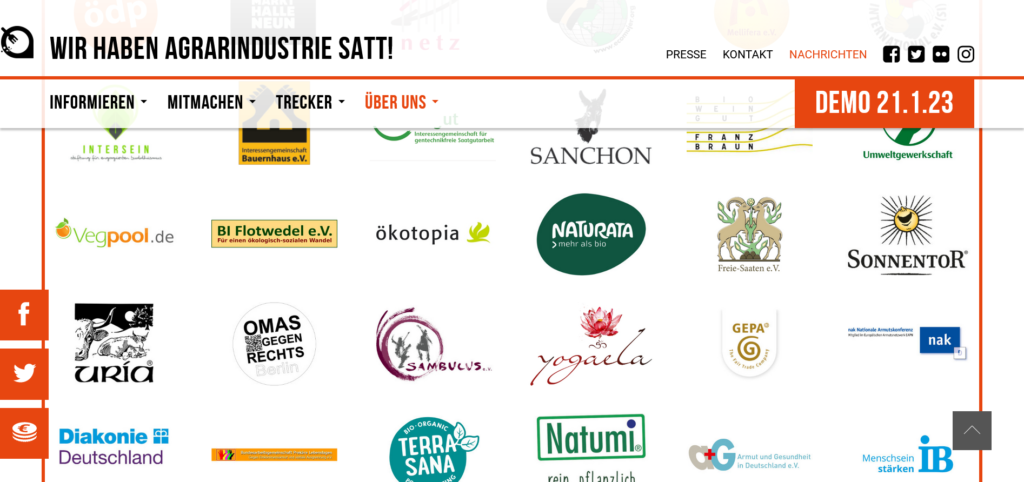
Mit einer Stimme?
Denn es gibt Zeiten, in denen ist es wichtig, mit einer Stimme zu sprechen, zusammen mit anderen, einen gemeinsamen Nenner und eindeutige Slogans zu finden, um miteinander Veränderungen einzuleiten. Morgen ist so ein Tag. Morgen erheben wir unsere Stimme für den sozialen und ökologischen Umbau unserer Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Gleichzeitig beunruhigt mich in diesen Lützerath-Wochen der lautstarken Proteste, der eskalierenden Konflikte, demonstrativen Schulterschlüsse und flammenden Freund-Feind-Kommunikation die große Zahl der zornigen Vereinfacher:innen mit ihrem Beharren auf Patentrezepten.
Sie haben die vermeintliche Lösung, sie wissen, was gut und böse ist. An der Abbruchkante entscheidet sich, so glauben sie offensichtlich, das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Das ist zu einfach. Aber sehr viele geben ihnen recht.
Gefahr der Kompromisslosigkeit
Doch die Komplexität der Probleme unserer Zeit passt nicht zu der Kompromisslosigkeit, den die Problemlösungsansätze der Protestierenden verlangen. Das gilt für wirksame Strategien gegen den Klimawandel wie für Corona, die Fragen nach Krieg und Frieden in der Ukraine oder den Fachkräftemangel.
Keine Kompromisse machen zu wollen, die Berechtigung anderer politischer Wege abzulehnen – da verfestigt sich eine Haltung, die in einer Demokratie alles andere als unproblematisch ist: Sie folgt einem zutiefst autoritären Konzept. Dieser Denkweise ist Toleranz fremd, ohne die es aber keinen demokratischen Kompromiss und damit keine Demokratie geben kann.
„Demokratie ist tolerant gegenüber allen Möglichkeiten, muss aber gegen Intoleranz selber intolerant werden können“, schrieb der Philosoph und Psychiater Karl Jaspers vor vielen Jahren. Nicht in der anderen Meinung liegt die Gefahr, sondern in einer kompromisslosen Intoleranz dieser gegenüber.
Verlust der Mehrdeutigkeit
Geschärft wird mein Unbehagen durch ein Büchlein, das ich in den vergangenen Wochen mit Gewinn gelesen habe: der preisgekrönte kulturkritische Essay des Arabisten Thomas Bauer „Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust von Mehrdeutigkeit und Vielfalt“. 2018 erschienen, ist er gerade in den aktuellen Disputen mit ihren mit großer Unversöhnlichkeit vorgetragenen Argumenten lohnend zu lesen.
Bauer denkt über die besorgniserregende und zunehmende Unfähigkeit nach, mit Ambiguitäten und Ambivalenzen zu leben und spannt einen Bogen vom Rückgang der Artenvielfalt und dem Aussterben von Sprachen hin zu kulturellen Prozessen, die von dem Bestreben motiviert sind, Vieldeutigkeit einzuebnen, um vermeintliche Eindeutigkeiten herzustellen.
Wurzel des Fundamentalismus
Ob Unfehlbarkeitsdogma oder Cancel Culture: Die Wurzel für Fundamentalismen liegt nach Bauer in diesem Prozess. Nicht nur in religiösen Kontexten, sondern eben überall, wo es Mittel und Ziel ist, Mehrdeutigkeiten zu vermeiden und Perspektiven, die der eigenen zuwiderlaufen, zurückzuweisen und zum Verstummen zu bringen.
Demokratiepolitisch, für das Zusammenleben in einer vielfältigen offenen Gesellschaft, eine toxische Tendenz. Unabhängig davon, aus welchem weltanschaulichen Lager sie kommt. Wer Mehrdeutigkeiten nicht tolerieren kann, wer Eindeutigkeit durchsetzen muss, wird Vielfalt kaum aushalten und gestalten können.
Auch an der Abbruchkante in Lützerath und unter den blockierten und blockierenden Straßenkämpfer:innen der „Letzten Generation“ gedeiht diese Unfähigkeit, mit Ambivalenzen leben zu können. Letztlich gefährdet diese Haltung nicht nur die Demokratie, sondern auch unsere (Mit-) Menschlichkeit. Um noch einmal Jaspers zu zitieren: „Dass wir miteinander reden können, macht uns zu Menschen.“
Vieldeutigkeit aushalten
Mich besorgt das, denn die komplexen, vieldeutigen Herausforderungen unsere Zeit, übrigens auch das Zusammenleben in unsere freien, offenen Gesellschaft der vielfältigen Lebensentwürfe und Vorstellungen vom guten Leben – sie alle brauchen leidenschaftliche Denker:innen und Mitgestalter:innen mit Ambiguitätskompetenz.
Also Leute, die in der Lage sind Vieldeutigkeit und daraus entstehende Unsicherheit zur Kenntnis zu nehmen, auszuhalten und gemeinsam Gestaltungswege einzuschlagen, die der Komplexität am ehesten gerecht werden. Leute, die die Freiheit der Andersdenkenden respektieren, ohne in das andere Extrem des „Anything goes“ zu geraten. Denn auch die Versuchung, das freie Nebeneinander der unterschiedlichen Auffassungen vom guten Leben als Einladung zur „Gleich-Gültigkeit“ aufzufassen, ist toxisch für unser Zusammenleben. Nichts ist egal.
Ambiguitätstoleranz braucht die Bereitschaft, sich zurückzunehmen und die Bedürfnisse und die Andersartigkeit der anderen ernst zu nehmen. Unsere jüdisch-christliche Tradition bringt hier übrigens die Liebe ins Spiel, ohne die bekanntlich alles nichts ist: Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe – sie immer wieder neu in eine gute Balance zu bringen gilt als das zentrale Gebot. Sich daran zu orientieren kann weiterhelfen: auch eine Variante vom Hashtag „aus Liebe“.
Die Kunst des Streitens
Für unsere Prozesse der politischen und gesellschaftlichen Wegfindung ist die Kunst des konstruktiven Streitens zentral. Und hier hat unsere Gesellschaft aktuell deutlich Luft nach oben. Nicht nur, wenn es um die Gestaltung der sozial-ökologischen Transformation geht. Zu oft mutieren öffentliche Debatten zum reinen Überschriften-Schlagabtausch: eskalieren, fahren sich fest oder verenden in unüberbrückbaren Polarisierungen. Und wie im digital-medialen Boxring, scheint das klassische K.o. des Gegners das erklärte Ziel zu sein.
Aber die komplexen Herausforderungen unserer Gegenwart werden keine argumentativen Haudrauf-Verfahren lösen. Nachhaltige Lösungen sind auch in griffigen Slogans selten zu fassen. In unserer Welt der vielen Perspektiven und Interessen brauchen wir für die Gestaltung dieser Welt genau diese verschiedenen Sichtweisen. Bei allen grundlegenden Meinungsverschiedenheiten kann es nur darum gehen, miteinander in Bewegung zu bleiben. Agilität statt Aggressivität.
Mehr Tanz, weniger Kampf
In der sehenswerten Ausstellung „Streit“ im Berliner Museum für Kommunikation bin ich kürzlich auf den Tanz als wunderbares Bild für konstruktives Streiten gestoßen. Nicht ringen, nicht kämpfen, kein Schlagabtausch – sondern tanzen.
Wie würde es unsere Kontroversen verändern, wenn wir sie tänzerischer verstehen würden? Taktgefühl und ein Gefühl für das Gegenüber helfen. Sich auf Regeln verständigen, die es ermöglichen, aufeinander bezogen zu bleiben. Dem anderen Raum geben und sich gegenseitig so wenig wie möglich auf die Füße treten, um dann vielleicht miteinander neue Schritte zu finden, auf die alleine niemand gekommen wäre.

